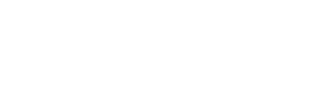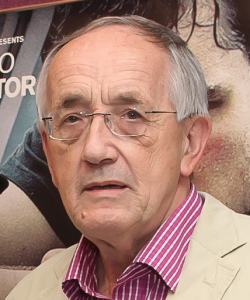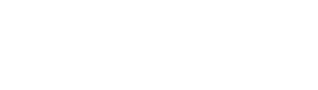
Der Film
Über 600 Jahre, von 1300 - 1941, lebten die Gottscheer in einem relativ abgeschlossenen Gebiet von 860 km2. Während des 2. Weltkrieges mussten auf Grund eines Abkommens zwischen Deutschland und Italien fast alle Gottscheer ihre Heimat verlassen und ins Umsiedlungsgebiet bei Rann an der Save in die Untersteiermark ziehen.
Mit dem Ende des 2. Weltkrieges sind die Gottscheer vor den Partisanen aus Jugoslawien geflüchtet. Ohne Hab und Gut, aber mit dem Glück, das eigene Leben gerettet zu haben, fanden die Gottscheer in aller Welt eine neue Heimat. In vielen Gottscheer Vereinen in Österreich, Deutschland, USA, Kanada, aber auch in Slowenien, pflegen sie noch heute ihre Gottscheer Kultur. Es gibt noch Zeitzeugen, die ‚Gottscheerisch‘ (ein Althochdeutsch) sprechen, es gibt Filme, Fotografien, Ruinen, Gedenkstätten in Klagenfurt und Graz, ein Museum in Gottschee, heute als Kočevje bekannt.
Der Dokumentarfilm widmet sich dem fast verlorenen Kulturerbe der Gottscheer, wobei die Erzählung in der ebenso fast verlorenen Sprache, dem GOTTSCHEERISCHEN, gehalten wird. Ein letzter Versuch, diese Kultur und speziell diese einzigartige deutsche Sprache für die Nachfahren und für das Weltkulturerbe zu erhalten.
Die Geschichte der Gottschee beginnt mit den Ortenburgern, einem Adelsgeschlecht in Oberkärnten. Auf deren Erbe, der Burgruine Ortenburg, beginnt auch die filmische Erzählung.
Regieexplikation
vom Regisseur, Uros ZavodnikDamit wir diese Sprache durch die Erzählung über das Kulturerbe der Volksgruppe für die Nachfahren und das Weltkulturerbe erhalten, haben wir beschlossen, den ganzen Film, d.h. die Narration des Filmes in ‚Gottscheerisch‘ zu gestalten. Da alles in Kärnten begonnen hat, beginnt hier auch die filmische Erzählung - in der Ruine vom Schloss Ortenburg bei Spittal an der Drau. Der ‚Alt‘-Gottscheer (Frank Mauser, Jahrgang 1938), der noch im ‚Gottscheerland‘ geboren wurde, erzählt seiner Nichte in seiner Muttersprache, in Gottscheerisch, die Geschichte über seine eigene Kultur. Die Reise in die Vergangenheit beginnt, wobei immer wieder zurück nach der Ortenburg, in die heutige Zeit, geblickt wird. Die Ruinen hier, die Ruinen dort, eine Volksgruppe scheint für immer bald in Vergessenheit zu geraten. Die ‚echten‘ Gottscheer gehören ja einer Vorkriegsgeneration an. Ihr Blick in die Zukunft ist mit großen Erwartungen verbunden, zumindest sollte ihre einzigartige Sprache von den Nachfahren erhalten werden. Es wird nicht chronologisch erzählt, das einzige, was als ‚roter Faden‘ zu betrachten ist, ist die deutsche Sprache aus der Mittelalter, die die Gottscheer als einzigartige Sprache erhalten haben. Nur wenige sprechen sie noch. Wie sie im Gottscheerland gelebt haben, ihre Kultur gepflegt haben, ist mit Erinnerungen verbunden, die nicht chronologisch erscheinen. Zum Glück wurde ihre Kultur auch durch alte Vor- und Nachkriegsfilmaufnahmen (16mm Film) und Fotografien dokumentiert, ansonsten ist zwischen den Ruinen und einigen noch erhaltenen Gebäuden im ‚Gottscheerland‘ wenig zu finden. Deswegen war es zum heutigen Zeitpunkt (21. Jahrhundert) wichtig, auch dies in das Kameraobjektiv einzufangen und im Film durch die Mischung mit Archivmaterial und Erzählungen der ‚Altsiedler‘ hervorzuheben. Aus diesem Grund wurden die Aufnahmen, die unser Team im heutigen Gottscheerland (Kočevje und Umgebung), aber auch in Kärnten und in den USA gemacht hat, mit Aussagen und Archivmaterial verknüpft. Es geht um eine einzigartige dokumentarische Erzählung, die zwischen Gottscheern in Österreich, Slowenien, Amerika, Deutschland u.a., wie auch zwischen den Deutschen und Slowenen für Aufmerksamkeit sorgen soll, da es ja um eine gemeinsame Geschichte geht, die für die Nachfahren, aber auch für das Weltkulturerbe wichtig ist, da jedes verlorene Kulturerbe dokumentiert und zumindest dadurch erhalten werden sollte. Dieser Dokumentarfilm ist anders, denn er ist komplett in Gottscheer Sprache gestaltet. Auch die Passagen, in denen gar nicht Gottscheerisch gesprochen wird, werden in Gottscheerisch synchronisiert. Für den Rest der Welt wird die Erzählung durch Untertitel in Deutsch, Englisch, Slowenisch und eventuell auch in anderen Sprachen verständlich gemacht.